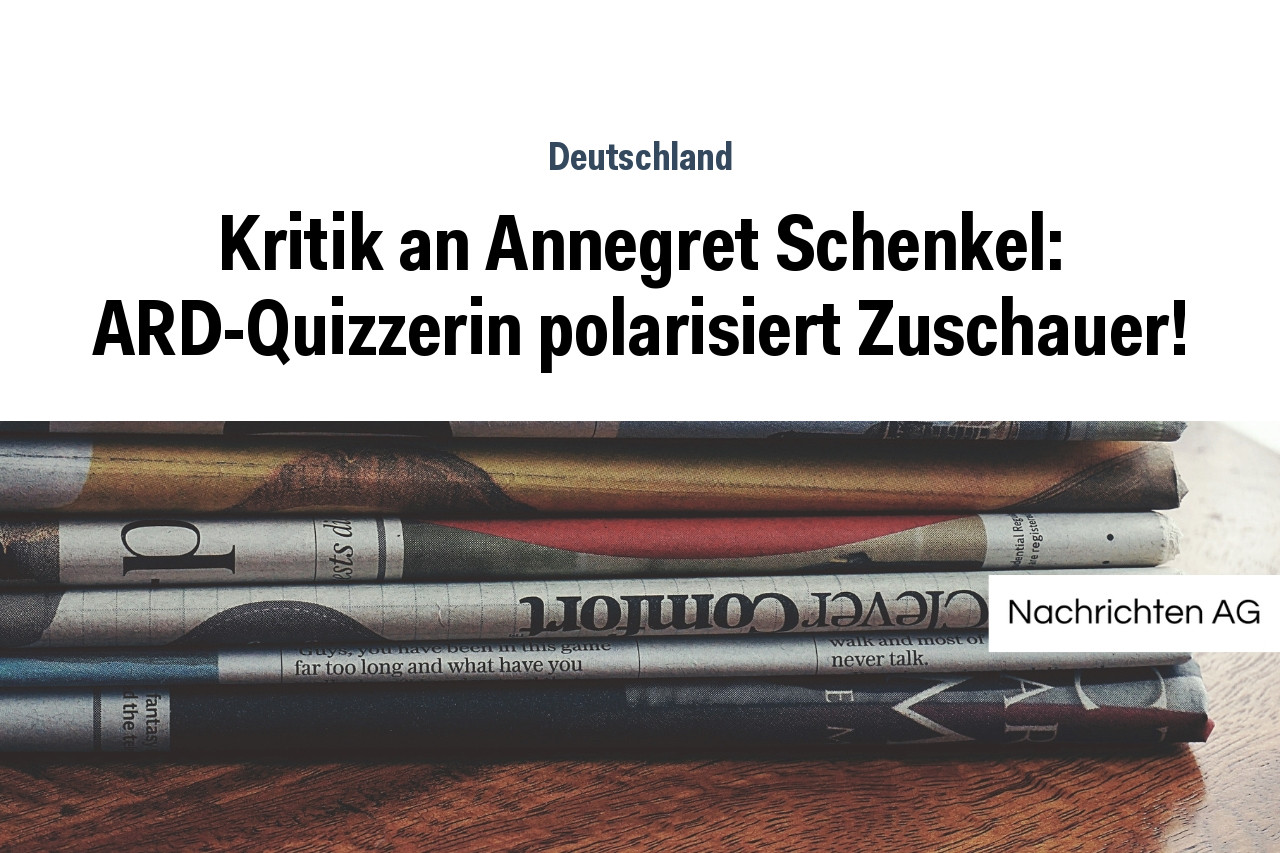
Kritik an Annegret Schenkel: ARD-Quizzerin polarisiert Zuschauer!
Die neue Staffel von „Gefragt – Gejagt“ startete am 23. April, Gejagt von Annegret Schenkel sorgt für Diskussionen unter Fans.

RTL2 zeigt in „Hartz und Herzlich“ das Leben von Bürgergeld-Empfängern wie Pamela, die nach Wohnung und Perspektive kämpfen.
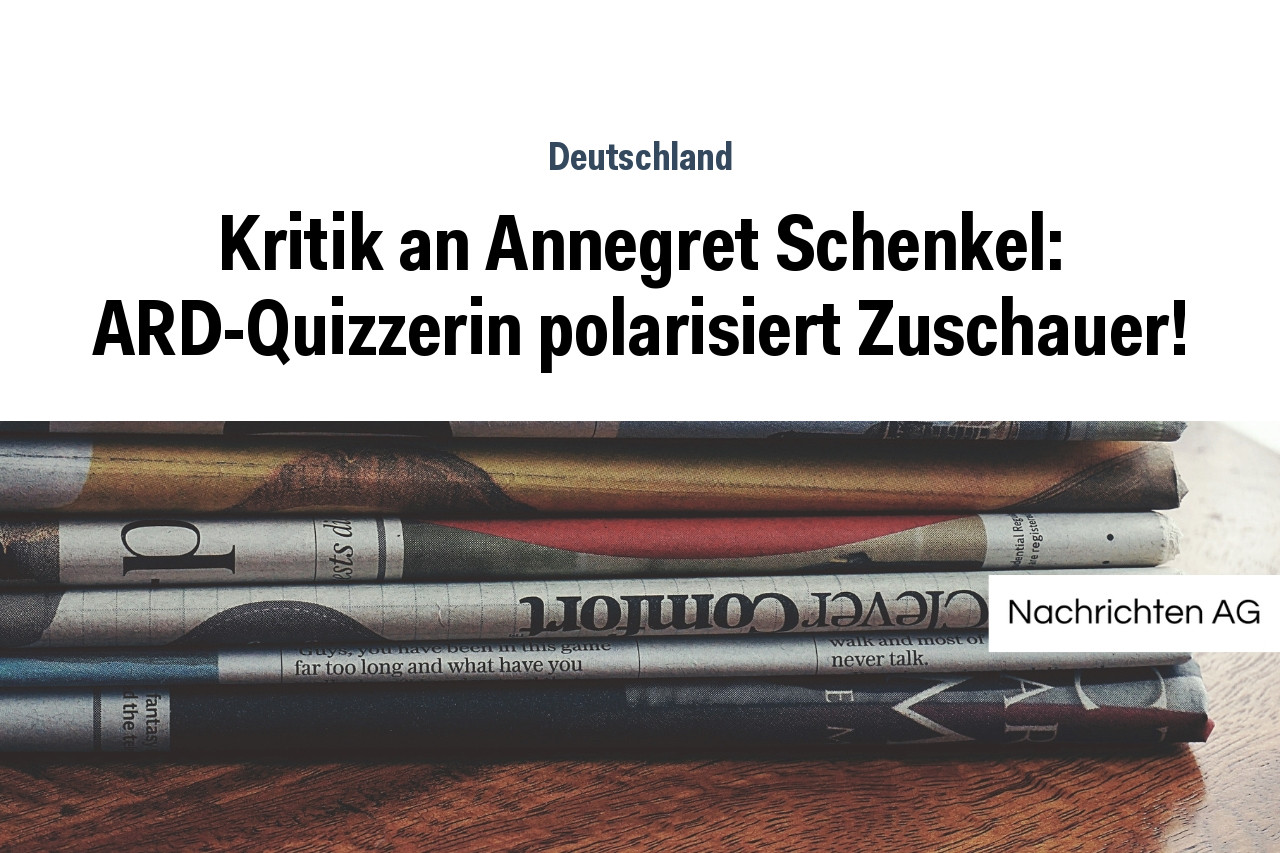
Die neue Staffel von „Gefragt – Gejagt“ startete am 23. April, Gejagt von Annegret Schenkel sorgt für Diskussionen unter Fans.

Erfahren Sie die aktuellen NBA-Spielergebnisse und Entwicklungen, einschließlich Franz Wagners Leistung, am 28. April 2025.
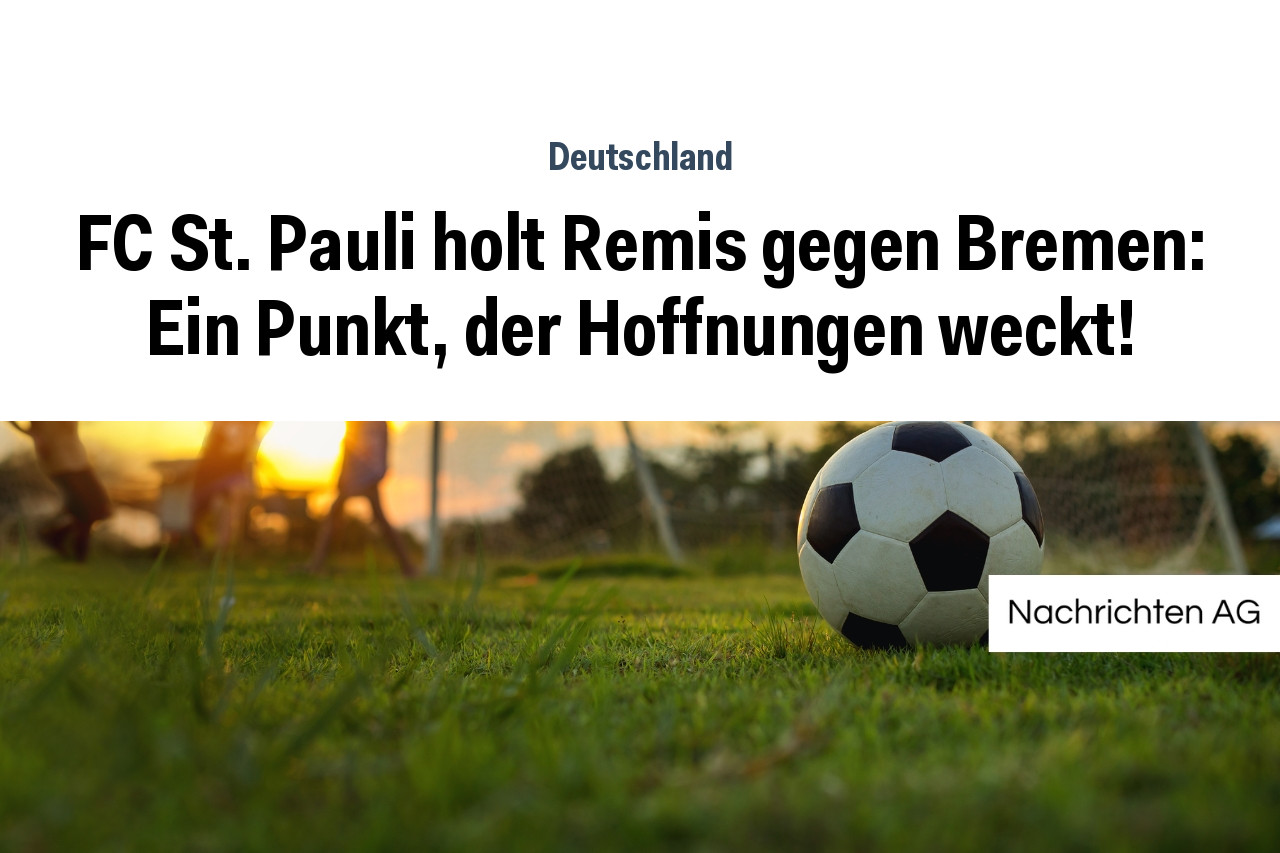
FC St. Pauli sichert sich ein 0:0 gegen Werder Bremen. Trainer Blessin lobt die positive Entwicklung des Teams in der Liga.
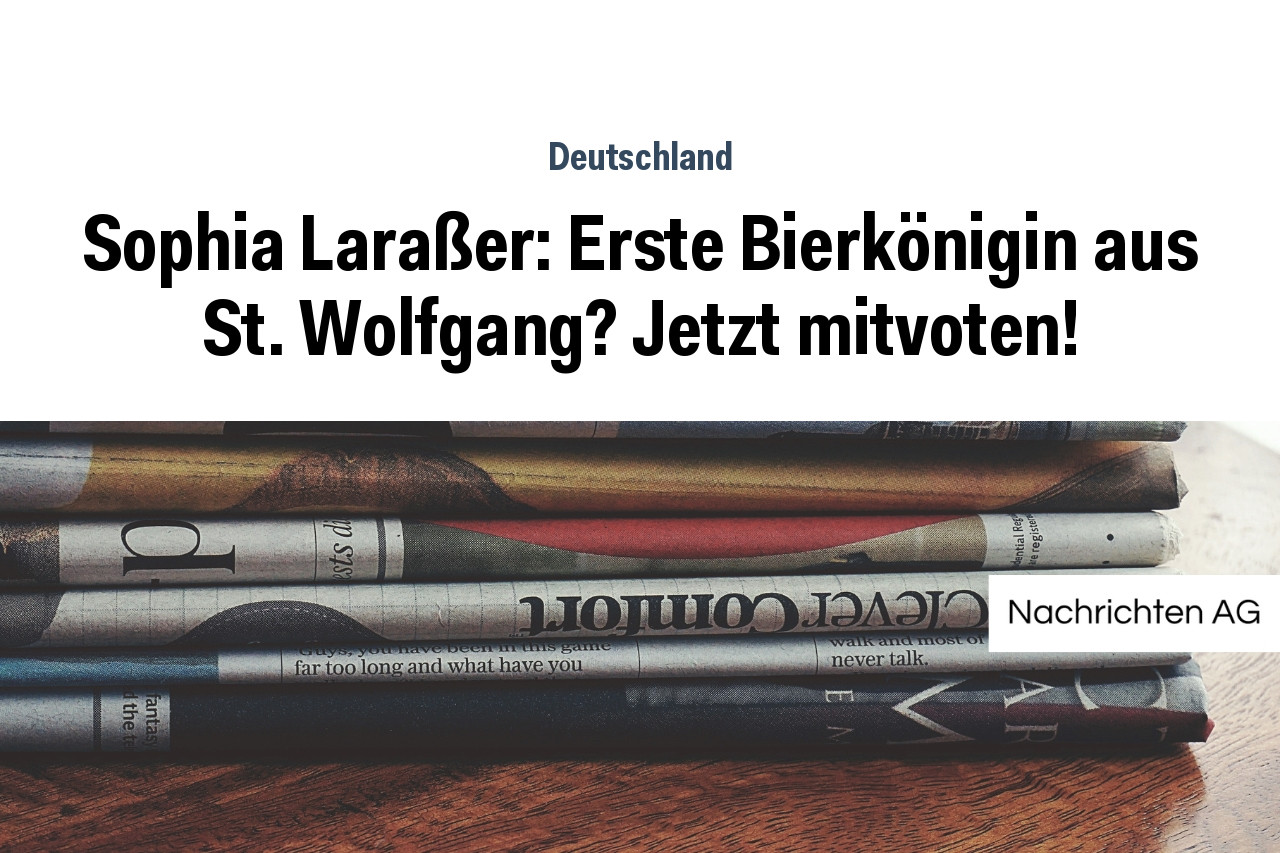
Sophia Laraßer aus St. Wolfgang kandidiert für die Bayerische Bierkönigin. Online-Voting entscheidet über den Finaleinzug am 22. Mai.
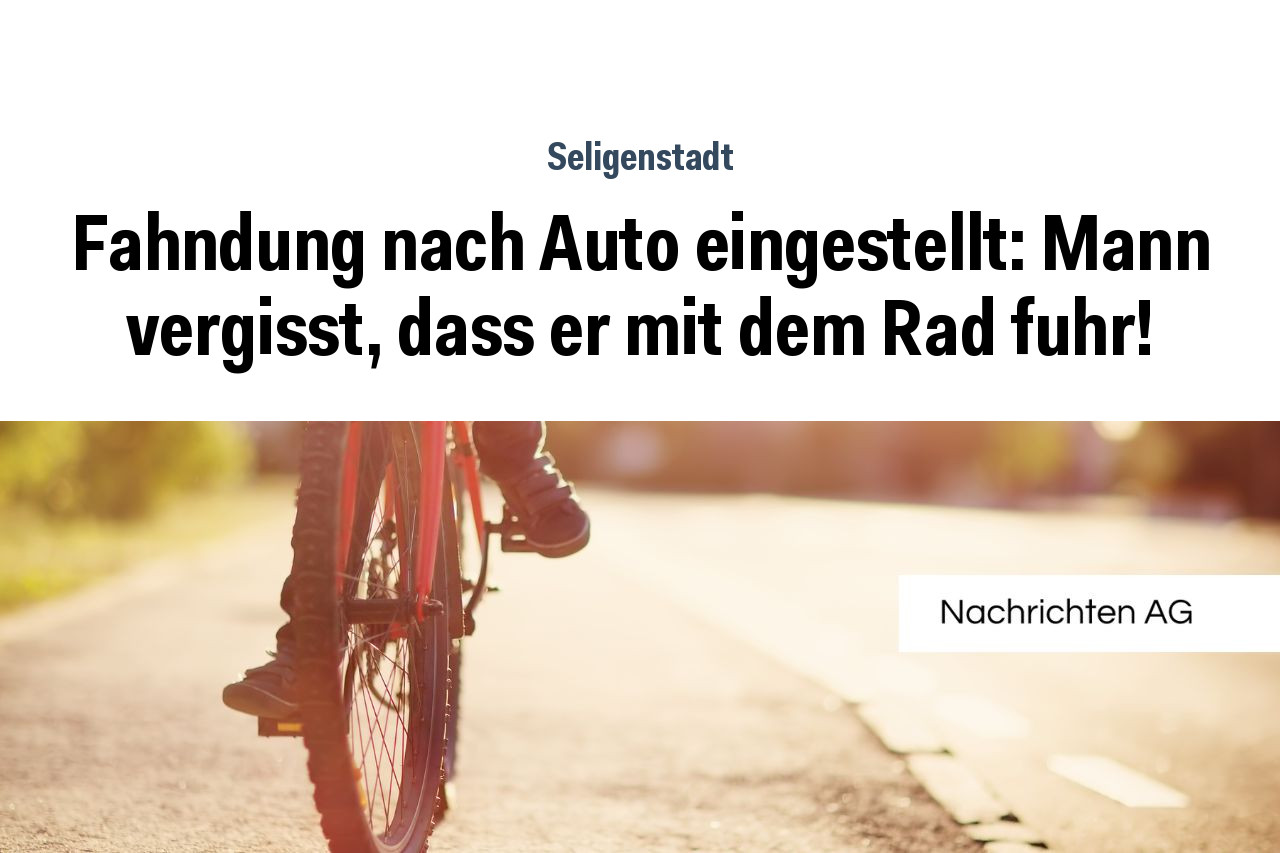
Ein Einkauf in Seligenstadt führt zu einem kuriosen Missverständnis: Mann sucht vergeblich sein Auto - es war nie weg.
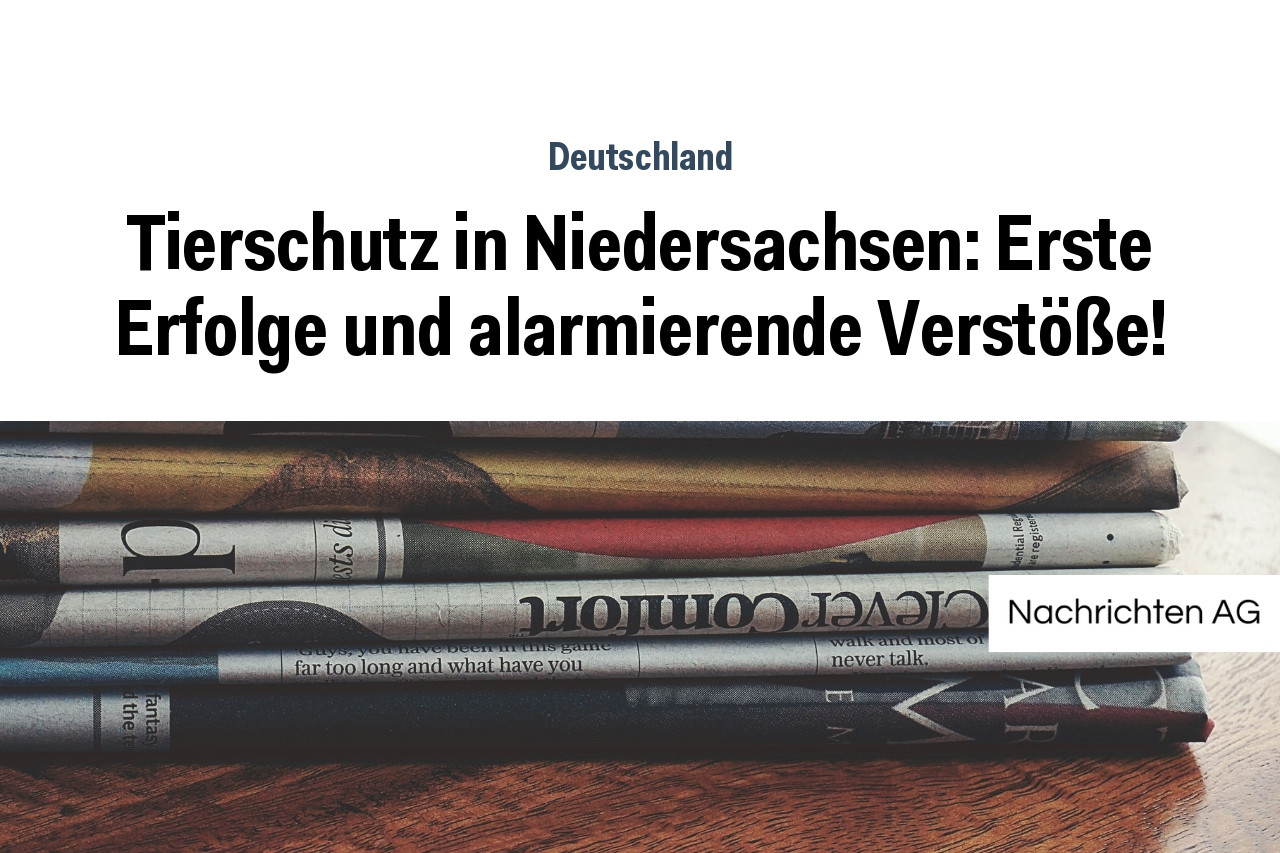
Die aktuellen Tierschutzverstöße in Niedersachsen und Bremen 2023: Rückgang der Zahlen, neue Gesetzesänderungen und ihre Bedeutung.

Neue Umfrage zeigt AfD mit 29% in MV führend vor SPD (21%). Wählerunsicherheiten und mögliche Koalitionen im Fokus.

Der Europa-Park feiert 50 Jahre, während ein Prozess wegen Missbrauchs in Konstanz beginnt. Aktuelle Nachrichten aus Baden-Württemberg.

Erfahren Sie, wie Metallbau Ledtermann aus Höhfröschen durch präzises Handwerk und Innovation Erfolgsgeschichte schreibt.