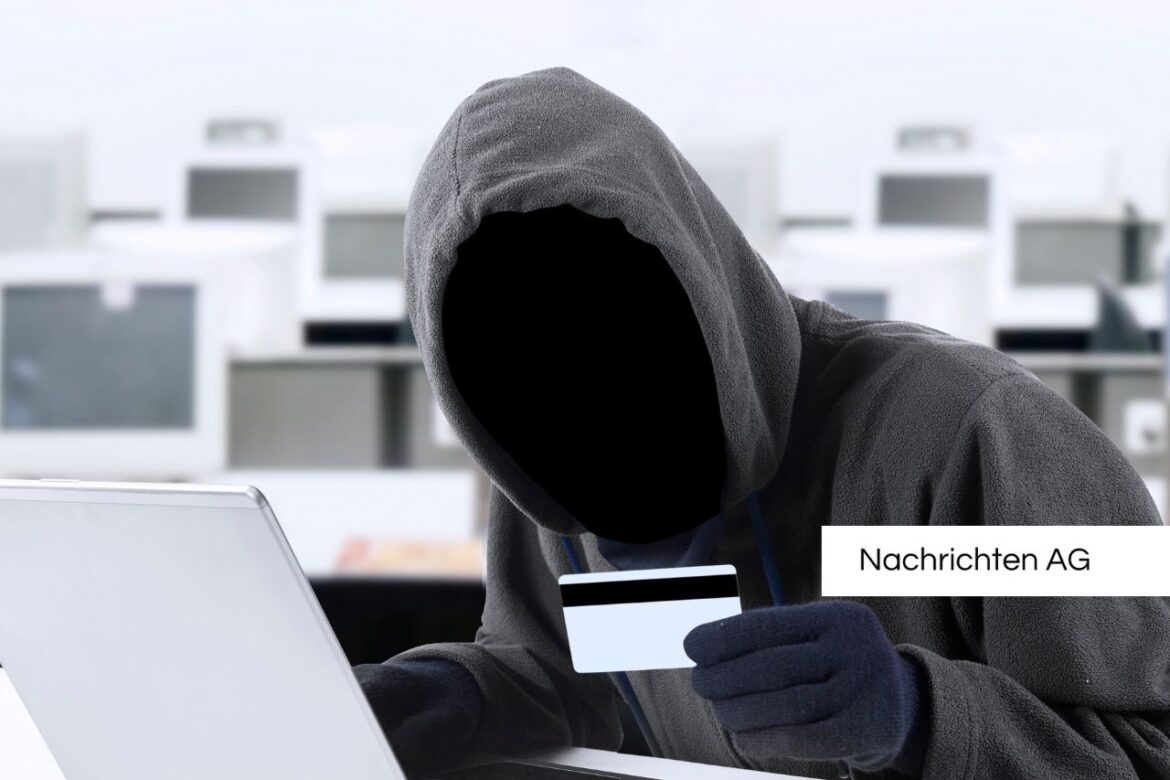
Das Jahr 2024 wird als das heißeste Jahr seit Beginn der globalen Aufzeichnungen betrachtet. Laut dem Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus betrug die globale Durchschnittstemperatur 15,10 Grad Celsius. Damit lag die Temperatur 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau, was die Entwicklung als alarmierend einstuft. Die Temperaturen in den letzten Jahren zeigen einen klaren Trend zur Erwärmung: Der Zweijahresdurchschnitt für 2023 und 2024 lag sogar bei 1,54 Grad über dem Referenzzeitraum.
Im vergangenen Jahr war nicht nur der Durchschnittswert außergewöhnlich, auch die extremsten Temperaturen wurden dokumentiert. So wurde am 22. Juli 2024 mit 17,16 Grad Celsius die höchste Temperatur des Jahres registriert. Dies ist kein Einzelfall, denn auch die Ozeane außerhalb der Polargebiete erreichten mit 20,87 Grad Celsius eine Rekordtemperatur. Gleichzeitig meldeten über 44 % der Erde am 10. Juli 2024 „schweren“ bis „extremen Hitzestress“.
Extreme Wetterbedingungen
Die Konsequenzen dieser Erwärmung sind verheerend und äußern sich in extremen Wetterereignissen weltweit. Hitzeperioden mit Temperaturen über 50 Grad, extreme Niederschläge und große Waldbrände prägten 2024. Diese Entwicklungen sind eine Folge des Klimawandels, den die Arbeitsgruppe I des Weltklimarats in einem Bericht als menschengemacht identifiziert hat. Extreme Wetterereignisse, die früher selten vorkamen, haben sich in ihrer Häufigkeit deutlich erhöht und können nun in kürzeren Abständen auftreten, wie zum Beispiel Küstenüberschwemmungen.
Der Anteil der Treibhausgase in der Atmosphäre erreichte alarmierende neue Rekordwerte, während der hohe Ausstoß menschengemachter Treibhausgase als Hauptursache für diese extremen Temperaturanstiege und Wetterphänomene identifiziert wurde. Vor allem Kohlendioxid und Methan tragen entscheidend zur Erderwärmung bei, und die aktuelle Situation stellt die Versprechen des Pariser Klimaabkommens von 2015 infrage, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.
Regionale Auswirkungen und Zukunftsprognosen
Die Auswirkungen des Klimawandels sind überall zu spüren. Im Jahr 2023 stellten die Fachleute fest, dass jede der letzten zehn Jahre zu den wärmsten Jahren gehörte, wobei 2023 und 2024 die höchsten jemals aufgezeichneten Temperaturen zu verzeichnen hatten. Regionen wie Nordamerika erlebten beispielsweise eine durchschnittliche Temperatur von 2,01 Grad über dem Referenzzeitraum, während Europa und Südamerika ebenfalls Rekordwerte meldeten.
Die Prognosen langfristig sind besorgniserregend. Ohne drastische Reduzierungen der Treibhausgasemmissionen könnte die Erdtemperatur bis Ende des Jahrhunderts auf bis zu 3,5 Grad steigen. Wenn die Klimaziele jedoch bis 2050 eingehalten werden, könnte diese Schätzung auf 2,7 Grad gesenkt werden, mit einer optimalen Zielvorgabe von 1,9 Grad, was jedoch erhebliche internationale Anstrengungen erfordert.
Um die katastrophalen Folgen des Klimawandels zu bekämpfen, ist die weltweite Zusammenarbeit unerlässlich. Empfehlungen für Deutschland umfassen den schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien sowie den zügigen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, um langfristig die Treibhausgasemissionen zu senken und die Klimakrise zu bewältigen. Der Klimawandel erfordert ein sofortiges Handeln, um unsere Zukunft zu sichern.
Die gesamte Menschheit steht in der Verantwortung, das Klima zu schützen und die Erderwärmung zu stoppen. Der dringende Handlungsbedarf und die ergreifenden Maßnahmen müssen jetzt, und nicht erst in der Zukunft, zur obersten Priorität werden. Die aktuelle Situation ist nicht nur ein Umweltthema, sondern betrifft alle Aspekte des Lebens auf der Erde.
Für weitere Informationen über die Entwicklungen und die Prognosen des Klimawandels siehe Remszeitung, Umweltbundesamt und WWF.