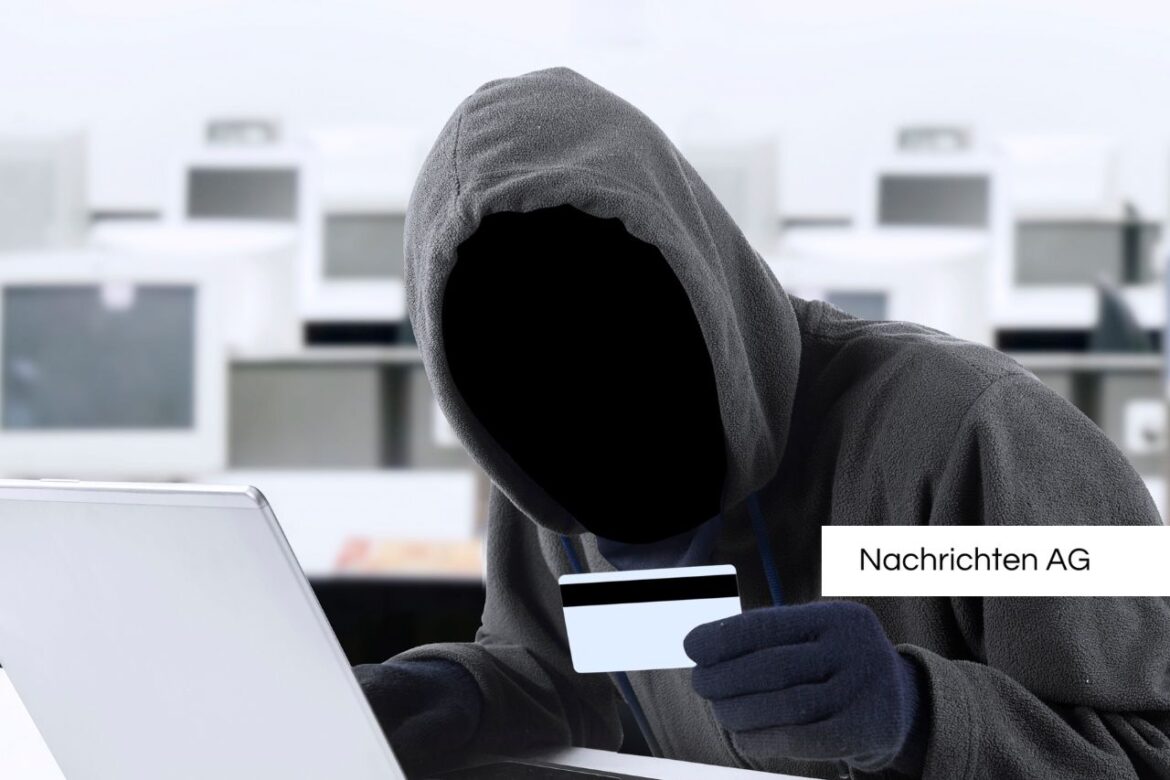
Im Januar 2023 stellte die Deutsche Telekom alle Telefonzellen in Deutschland außer Betrieb. Ein deutlicher Rückgang der Nutzung und der Funktionsfähigkeit vieler Geräte, häufig geschädigt durch Vandalismus, war der Grund für diese Entscheidung. In Köln stehen derzeit noch 106 Telefonzellen ungenutzt bereit, während bereits 63 Standorte abgebaut wurden. Dies bedeutet, dass trotz der fortschreitenden Digitalisierung und der weitverbreiteten Nutzung von Mobiltelefonen die letzten Überbleibsel der früher allgegenwärtigen Fernsprecher in der Stadt immer mehr dem Verfall überlassen werden, wie ksta.de berichtet.
Der für den Abbau erforderliche Prozess hat sich als komplex und zeitaufwändig erwiesen. Um mit dem Abbau fortzufahren, müssen die Standorte zuerst stromlos geschaltet werden, was von den jeweiligen Netzbetreibern, wie Rhein-Energie, durchgeführt wird. Diese Stromlos-Schaltung kann mehrere Monate in Anspruch nehmen. Der Abbau selbst erfordert Genehmigungen von der Stadt, deren Bearbeitungszeit in der Regel etwa 10 bis 15 Werktage dauert. Tagesaktuelle Verzögerungen lassen sich nicht ausschließen, insbesondere aufgrund von Veranstaltungen wie Karneval oder Weihnachtsmärkten. Angesichts dieser Umstände plant die Telekom, alle Telefonzellen bis Ende 2025 abzubauen, vorausgesetzt, alle Schritte werden rechtzeitig erledigt.
Der Wandel der Kommunikationsinfrastruktur
Die Bedeutung von öffentlichen Telefonen hat seit den 1990er Jahren kontinuierlich abgenommen. Damals, als telefonische Erreichbarkeit in Privathaushalten nicht selbstverständlich war, waren öffentliche Fernsprecheinrichtungen ein unverzichtbarer Teil der Telekommunikationslandschaft. Der erste „Fernsprechkiosk“ wurde bereits 1881 in Berlin eröffnet. Bis 1997 gab es in Deutschland über 160.000 öffentliche Telefonstellen. Dieser umfassende Rückgang von Fernsprechmöglichkeiten resultierte aus der schnellen Verbreitung von Mobilfunktechnologien und der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes, wie dstgb.de erklärt.
Die Deutsche Telekom musste schließlich auf die sinkende Nachfrage reagieren, die dazu führte, dass fast jedes dritte öffentliche Telefon im letzten Jahr keinen Umsatz mehr erzielte. Laut inside-digital.de erzielte der durchschnittliche Umsatz pro Standort nur noch im niedrigen Euro-Bereich pro Monat. Die Telekom begründete die Abschaltung auch durch den hohen Stromverbrauch der Geräte, der bis zu 1.250 kWh pro Jahr betrug.
Ein Erbe der Vergangenheit
Trotz der Abbaupläne gibt es in Köln und anderswo immer noch eine Vielzahl von Telefonzellen, die in ihrer Funktionalität stark eingeschränkt sind. Die verbleibenden Geräte zeigen in der Regel die Meldung „Entschuldigung, zur Zeit gestört“. Auch die Abwicklung des Abbaus ist von zahlreichen Herausforderungen geprägt, da es eine Koordination vieler Gewerke benötigt, um die schwerfälligen Genehmigungsprozesse in Gang zu setzen und die Rückbauarbeiten termingerecht durchzuführen.
Für die Stadt Köln bedeutet die Erhaltung dieser Telefonzellen zusätzliche Kosten. Die Stadt erhebt eine Gebühr von 12,90 Euro pro Standort und Monat, die weiterhin an die Telekom gezahlt werden muss, auch wenn die Nutzung der Geräte gegen null tendiert. Solange der Abbauprozess nicht abgeschlossen ist, bleibt die Frage im Raum, wie sinnvoll diese alten Relikte der Kommunikation noch sind.
Die Telekom hat den endgültigen Abbau der öffentlichen Telefone für die kommenden Jahre eingeplant, was einen weiteren Schritt in Richtung einer mobilfunkorientierten Zukunft darstellt. Der Niedergang der Telefonzellen ist nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine gesellschaftliche Veränderung, die den Wandel in unserem Kommunikationsverhalten widerspiegelt.