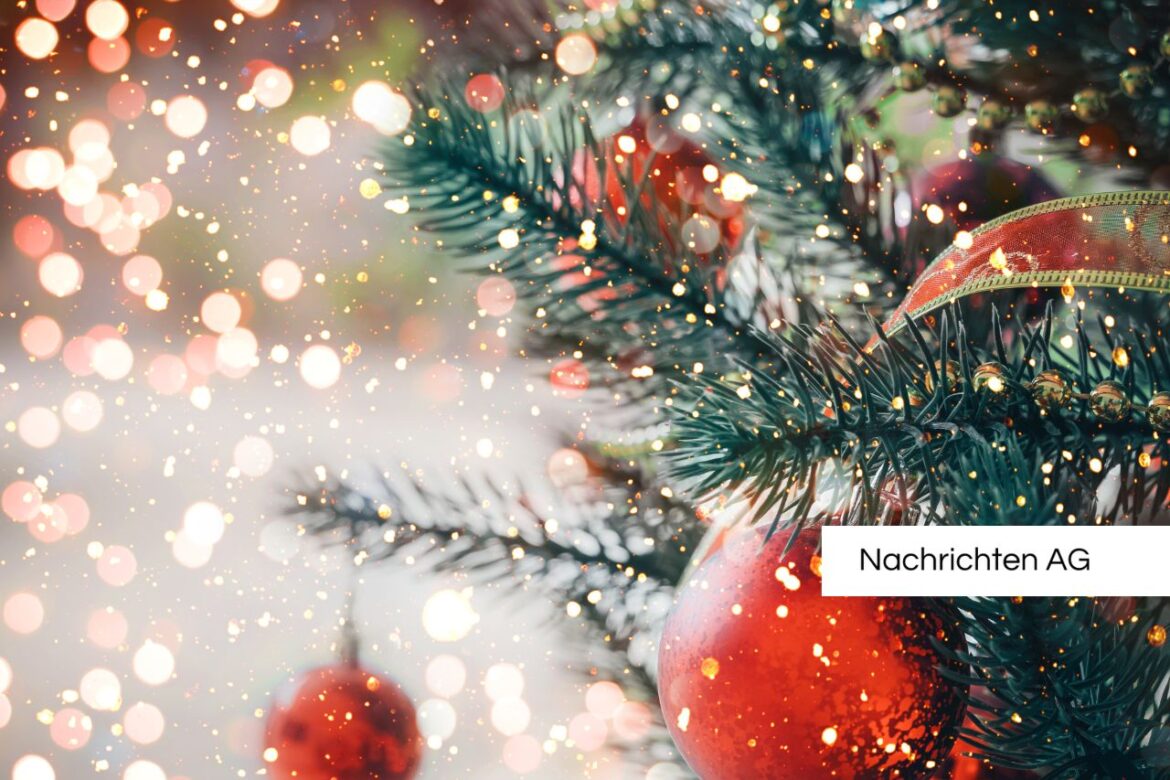
Am 20. Dezember 2024 führte Taleb Jawad Al Abdulmohsen, ein 50-jähriger in Deutschland anerkannter Asylbewerber aus Saudi-Arabien, einen verheerenden Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg aus. Mit seinem Auto raste er in eine Menschenmenge, was zu sechs Toten und einer dreistelligen Zahl von Verwundeten führte. Dies stellte einen der schwersten Vorfälle in Deutschland in den letzten Jahren dar. Abdulmohsen, der zuvor als Facharzt für Psychiatrie in Bernburg tätig war, wurde nach der Tat in die Justizvollzugsanstalt Dresden verlegt, um den Hinterbliebenen der Opfer fernzubleiben.
Vorfälle wie dieser werfen drängende Fragen zu dem Zustand der psychischen Gesundheit von potenziellen Tätern auf. Vor dem Anschlag hatte Abdulmohsen in einem Video deutlich gemacht, dass er sich verfolgt fühlte, da ein „deutscher Agent“ ihm einen Memory-Stick gestohlen habe. Ihm wird ein gravierender psychischer Zustand nachgesagt, mit Hinweisen auf Wahnvorstellungen und Verfolgungswahn. Diese Situation erinnert an einen anderen tragischen Fall in Aschaffenburg, wo am 22. Januar 2024 ein 28-jähriger afghanischer Asylbewerber in einer Messerattacke einen zweijährigen Jungen tötete.
Diskussion über psychische Erkrankungen
Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe entschied, die Ermittlungen zum Fall Abdulmohsen nicht zu übernehmen, da keine klare politische Motivation für die Tat zu erkennen sei. Politischer Druck auf die Behörden wächst jedoch, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Abdulmohsen seit 2015 als potenziell Verdächtiger bekannt war und 2014 bereits wegen einer Drohung verurteilt wurde. Der Vorfall in Aschaffenburg, der als „unfassbare Terrortat“ von Bundeskanzler Olaf Scholz beschrieben wurde, zeigt ebenfalls das Versagen der Behörden im Umgang mit psychisch auffälligen Asylbewerbern.
Beide Fälle fügen sich in eine größere Debatte über den Umgang mit psychischen Erkrankungen und Radikalisierung in Deutschland ein. Berichte zeigen, dass ein erheblicher Anteil von Inhaftierten unter psychischen Störungen leidet. Über ein Drittel der verurteilten Personen, die aufgrund extremistisch motivierter Straftaten inhaftiert sind, weisen psychische Störungen auf. Diese Problematik steht im Zusammenhang mit der Entwicklung und Verstärkung psychischer Erkrankungen durch traumatische Erfahrungen.
Radikalisierung und psychische Gesundheit
Besonders alarmierend ist, dass bei Inhaftierten im Zusammenhang mit islamistischem Extremismus zwischen 50 und 70 % psychische Problemlagen festgestellt wurden. Der Umgang mit psychisch belasteten Inhaftierten ist bereits Teil des Alltags in Justizvollzugsanstalten. Interne und externe Fachträger arbeiten an Distanzierungs- und Ausstiegsbegleitungen, um die Rückfallquoten zu senken.
Die Tendenz, dass psychische Erkrankungen in der Haft nicht adäquat behandelt werden, hat weitreichende Konsequenzen. Eine Analyse von forensischen Gutachten ergab, dass 81 % der Jugendlichen und 73 % der Erwachsenen Symptome psychischer Erkrankungen aufwiesen. Es gibt Forderungen zur Verbesserung der psychotherapeutischen Angebote kurzfristig, um psychische Erkrankungen effektiv zu adressieren und eine Radikalisierung zu verhindern.
Angesichts dieser Informationen wird deutlich, dass die Verknüpfung von psychischer Gesundheit und Straftaten, insbesondere in Hinblick auf mögliche Radikalisierungen, eine ernsthafte Herausforderung für die deutschen Behörden darstellt. Die Fälle in Magdeburg und Aschaffenburg sind nur die Spitze des Eisberges eines vielschichtigen Problems, das dringend einer umfassenden Lösung bedarf.
Remszeitung berichtet über die dramatischen Ereignisse in Magdeburg und Aschaffenburg.
Tagesschau beleuchtet die Hintergründe des Anschlags.
bpb analysiert die psychische Gesundheit von radikalisierten Straftätern in Deutschland.